Wissen
Rund um das Thema Nachhaltigkeit beschäftigen uns zahlreiche Fragen. Die wichtigsten aus allen Themenfeldern finden Sie hier beantwortet.
32/32
Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip, das wirtschaftliche, ökologische und soziale Belange gleichermassen berücksichtigt. Es bedeutet, natürliche Ressourcen wie Süsswasser, Rohstoffe und Energieträger so schonend und effizient wie möglich zu nutzen, um die Bedürfnisse der aktuellen Generation zu erfüllen, ohne die Lebensgrundlage kommender Generationen zu gefährden.

Die «Agenda 2030» ist ein globaler Aktionsplan der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung. Kern dieses Plans sind 17 übergeordnete Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs). Diese Ziele decken Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Geschlechtergleichheit, Klimaschutz, Erhalt der Biodiversität, Armutsbekämpfung und andere soziale, wirtschaftliche und ökologische Themen ab. Alle UNO-Mitgliedsländer haben sich verpflichtet, die Agenda 2030 national umzusetzen. Die Schweiz hat eine eigene «Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030» entwickelt, um diese Ziele zu realisieren.
Greenwashing ist eine Marketing-Strategie, bei der Unternehmen und Institutionen sich umweltfreundlicher darstellen, als sie tatsächlich sind, um ihr Öko-Image zu verbessern. Viele Konsumierende bevorzugen nachhaltig agierende Unternehmen, selbst wenn deren Produkte teurer sind. Da es schwierig ist, die tatsächliche Nachhaltigkeit von Produkten zu beurteilen, nutzen umweltschädliche Unternehmen gezielt Desinformationen, um ihre schlechte Ökobilanz zu verschleiern. Erfolgreiches Greenwashing kann die Gewinne steigern und neue Kunden anlocken.
Nachhaltig agierende Unternehmen werden von Investoren oft als langfristig stabil und wettbewerbsfähig angesehen, was den Zugang zu Kapital erleichtert. Zusätzlich können Unternehmen durch Massnahmen wie mehr Energieeffizienz, den Einsatz von Grünstrom und Abfallvermeidung Kosten senken. Nachhaltiges Wirtschaften steigert die Produktqualität und ermöglicht oft höhere Preise. Es fördert die Mitarbeiterbindung und macht das Unternehmen als Arbeitgeber attraktiver. Nachhaltige Unternehmensführung trägt dazu bei, Finanz-, Umwelt- und Arbeitsmarktrisiken zu reduzieren sowie Compliance-Verstösse und Reputationsschäden zu verhindern.
Bildung spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung von Nachhaltigkeit, indem sie das Bewusstsein für Umwelt- und Ressourcenfragen schärft und das nötige Wissen für eine nachhaltige Entwicklung vermittelt. Schulen, Universitäten und lebenslanges Lernen sind entscheidend für die Entwicklung einer nachhaltigen Kultur. In der Schweiz ist Bildung ein Grundrecht und das Bildungssystem zählt international zu den Spitzenreitern. Dennoch gibt es Herausforderungen wie die Qualität des Unterrichts und finanzielle Ungleichheiten bei Bildungsausgaben. Unternehmen können durch das duale Bildungssystem und Weiterbildungen zur Bildung beitragen, indem sie Lehrstellen anbieten und Inklusionsprogramme fördern.
Gleichstellung bedeutet, dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder anderen Merkmalen die gleichen Rechte und Chancen haben sollten. Es geht darum, Diskriminierung und Benachteiligung aktiv entgegenzuwirken und eine gerechte Teilhabe in allen Lebensbereichen zu fördern. In der Schweiz ist dieses Ziel noch nicht vollständig erreicht. Die Erfahrung von Diskriminierung hat in den letzten Jahren zugenommen, wie aus Daten des Bundesamts für Statistik hervorgeht.

Die globale Ernährung beeinflusst die Nachhaltigkeit erheblich. Die Fleischproduktion, lange Transportwege und der Einsatz von Pestiziden belasten die Umwelt. Nachhaltige Praktiken wie biologischer Anbau und die Unterstützung lokaler Landwirtschaft sind entscheidend. In der Schweiz verursachen Viehzucht und Futtermittelimporte hohe Treibhausgasemissionen und belasten Böden und Wasser. Zudem fallen jährlich 2,8 Millionen Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle an, was die Umwelt und Haushaltsbudgets belastet.

Ein Unternehmen gilt als nachhaltig, wenn es seine wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt identifiziert und nach anerkannten Standards wie den ESGs (Umwelt, Soziales, Governance) handelt. Dies beinhaltet die Reduktion von negativen Folgen wie Emissionen, die Sicherstellung fairer Arbeitsbedingungen und die regelmässige Prüfung der Einhaltung von Menschenrechten in den Lieferketten. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil des Unternehmensmanagements, das strategische Ziele, innovative Produkte, ressourcenschonende Betriebsabläufe und transparente Kommunikation umfasst.

Science based Targets (SBT) sind transparente und messbare Klimaziele für Unternehmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen wie CO2 oder Methan. Sie werden von der Science Based Targets Initiative (SBTi) auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Empfehlungen entwickelt. Damit können Unternehmen sicherstellen, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Dieses hat zum Ziel, die Erderwärmung deutlich unter 1,5 Grad Celsius – mittlerweile eher unter 2 Grad Celsius – zu halten. Der «Net-Zero-Standard» von SBTi hilft Unternehmen, ihre Emissionen langfristig nach einem festen Plan auf netto Null abzusenken.
Weitere Informationen
Das Treibhausgasprotokoll (Greenhouse Gas Protocol) unterstützt Unternehmen dabei, den Ausstoss von Treibhausgasen zu messen, zu managen und zu reduzieren. Dabei werden alle Emissionskategorien berücksichtigt, die in Scope 1, 2 und 3 unterteilt sind. Scope 1 umfasst direkte Emissionen wie die Verbrennung von Energieträgern innerhalb des Unternehmens. Scope 2 bezieht sich auf indirekte Emissionen, die durch den Einkauf und Verbrauch von Strom, Wärme oder Kälte entstehen. Scope 3 umfasst weitere indirekte Emissionen, die durch die vor- und nachgelagerten Lieferketten entstehen, einschliesslich Transport und Entsorgung. Damit werden auch die Emissionen berücksichtigt, die durch externe Aktivitäten entstehen, die jedoch im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens stehen.
Corporate Governance, zu Deutsch «Grundsätze der Unternehmensführung», umfasst alle internationalen und nationalen Regelungen und Verfahren zur Führung und Überwachung eines Unternehmens. Eine gute Corporate Governance ist essentiell für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Sie beinhaltet die Einbeziehung der Interessen aller Stakeholder, qualifizierte Aufsichts- und Leitungsgremien und ein umfassendes Risikomanagement, das auch Menschenrechtsfragen und Lieferketten berücksichtigt. Gute Corporate Governance stärkt das Vertrauen der Stakeholder, vermindert Risiken und macht Unternehmen resilienter. Ein aktiver Verwaltungsrat spielt dabei eine zentrale Rolle und muss Nachhaltigkeit fest in der Firmenstrategie verankern.
Die Schweiz, als Wasserschloss Europas bekannt, verfügt über reichlich Süsswasserreserven aus Seen, Flüssen und den Alpen. Dennoch sind auch hier Wasserknappheit und Qualitätsprobleme eine Herausforderung. Jährlich werden 550 Milliarden Kubikmeter Wasser genutzt. Die Wasserqualität ist hoch, aber Pestizide und Nitrat aus der Landwirtschaft belasten das Grundwasser. Zudem verschmutzen Mikroplastik und Plastikabfälle aus verschiedenen Quellen die Schweizer Gewässer. Angesichts des Klimawandels drohen zunehmende Trockenperioden im Sommer und verstärkte Hochwasser, während die Biodiversität der heimischen Gewässer durch wärmere Temperaturen gefährdet ist.
Der sogenannte Green Deal ist ein umfassendes und langfristiges Programm der Europäischen Union, das darauf abzielt, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Dies bedeutet, dass die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf null reduziert und das Klima nicht mehr durch menschliche Aktivitäten beeinflusst werden sollen. Der Green Deal fördert Investitionen in saubere Energie, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, sowie in Verkehr und Digitalisierung. Die Schweiz hat ihre Position in das Konzept des Green Deals eingebracht und kann sich an Forschungsprojekten beteiligen.
Seit dem 1. Januar 2022 sind im Schweizer Obligationenrecht (OR) neue Bestimmungen für eine nachhaltige Unternehmensführung in Kraft, die grosse Schweizer Unternehmen verpflichten, umfassend über die Risiken ihrer Geschäftstätigkeit in den Bereichen Umwelt, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte sowie Korruptionsbekämpfung zu berichten. Diese Vorschriften beinhalten auch spezielle Sorgfaltspflichten in Bezug auf Konfliktmineralien und Kinderarbeit. Bereits zuvor existierten regulatorische Vorgaben, die verschiedene Aspekte nachhaltigen Handelns wie Arbeitsbedingungen und Abfallentsorgung regelten. Ergänzend trat am 1. Januar 2024 die Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange in Kraft, die für grosse Schweizer Unternehmen die verbindliche Umsetzung der international anerkannten Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) vorschreibt.
Die Klimakrise bedroht die Gesundheit durch gravierende Auswirkungen auf Ökosysteme und extreme Wetterereignisse wie Hitzeperioden und Überschwemmungen. Sie verschärft bestehende Risikofaktoren wie Luftverschmutzung und Ernährungsunsicherheit. Experten rechnen mit einem Anstieg von Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch mit Schwierigkeiten bei der Nahrungsmittelversorgung. Diese und andere Belastungen können zudem das Auftreten psychischer Störungen begünstigen. Die Klimakrise ist somit eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit, die weitreichende gesundheitliche und sozioökonomische Folgen haben kann.
Die Produktion von Kleidung belastet die Umwelt durch hohen Wasser-, Rohstoff- und Energieverbrauch sowie den Einsatz von Chemikalien. Baumwolle benötigt den Einsatz von Pestiziden und Chemikalien, während synthetische Stoffe wie Polyester Mikroplastik freisetzen und auf Erdöl basieren. Auch Transport und Logistik sind CO₂-intensiv. Insgesamt verursacht die Textilindustrie mehr CO₂-Emissionen als Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Die Nutzung der Kleidung trägt durch das Waschen synthetischer Kleidung weiter zur Umweltbelastung bei, da dabei Mikroplastik freigesetzt wird. Zudem verschärfen Fast Fashion und Textilabfälle das Problem.

Der anthropogene Klimawandel beschreibt die durch menschliche Aktivitäten verursachte Veränderung des globalen Klimasystems – zum Grossteil bedingt durch den Ausstoss an Treibhausgasen wie CO₂ oder Methan. Während das Klima schon immer natürlichen Schwankungen unterlag, hat sich seit der Industrialisierung die Temperatur unnatürlich schnell erhöht. Global sind die Durchschnittstemperaturen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um 1,1 Grad gestiegen, in der Schweiz sogar um 2,8 Grad (Stand 2024). Diese Erwärmung hat drastische Auswirkungen: Gletscher haben seit 1931 über die Hälfte ihrer Masse verloren, Unwetter nehmen an Intensität zu, Permafrostböden tauen auf und Bergregionen destabilisieren sich.
Das 1,5-Grad-Ziel, das 2015 an der Pariser Klimakonferenz vereinbart wurde, strebt an, die globale Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf höchstens 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Dieser Wert markiert den Punkt, ab dem wichtige globale Klimasysteme gefährdet sind und irreversible Veränderungen drohen. Im Rahmen des Abkommens hat sich die Schweiz verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 50 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren und bis 2050 den Netto-Null-Status zu erreichen. Aktuell liegt die globale Temperatur bereits um 1,1 Grad über dem vorindustriellen Niveau, es verbleiben also noch 0,4 Grad, um die 1,5-Grad-Marke zu erreichen.
Das Klima hängt von globalen Prozessen und Systemen ab, die durch Faktoren wie die Freisetzung von Treibhausgasen und ökologische Veränderungen beeinflusst werden. Klimaszenarien basieren auf komplexen Modellen und Simulationen, die physikalische, chemische und biologische Prozesse berücksichtigen. Aufgrund der Unsicherheiten bei zukünftigen sozioökonomischen und technologischen Entwicklungen sind genaue Vorhersagen schwierig. Dennoch bieten diese Szenarien plausible und wissenschaftlich fundierte Prognosen darüber, wie sich das Klima entwickeln könnte und welche Auswirkungen das auf Mensch und Umwelt haben kann.
Nachhaltigkeitsmanagement bedeutet, dass Unternehmen ihre negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt durch ihre Geschäftstätigkeit und Lieferketten erkennen, vermeiden oder abmildern. Es beinhaltet die Analyse und Bewältigung von klimabedingten Risiken, ein Commitment zur Nachhaltigkeit seitens der Unternehmensführung, die Durchführung einer Status quo-Analyse, die Entwicklung nachhaltiger Strategien und klarer Zuständigkeiten, regelmässige Berichterstattung, kontinuierliche Datenerhebung und Evaluation sowie die Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Wichtig sind auch die Einbeziehung der Stakeholder und die Einhaltung internationaler Standards und Regularien, um Transparenz und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Die Klimakrise wird hauptsächlich durch Treibhausgasemissionen verursacht, die bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Stromerzeugung freigesetzt werden. Um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, ist der Übergang zu erneuerbaren Energiequellen wie Sonnen-, Wasser- und Windenergie entscheidend. Diese Quellen helfen dabei, die Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas zu verringern und damit die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren. Der Einsatz erneuerbarer Energien ist zentral im Kampf gegen den Klimawandel. Gleichzeitig kann die Klimakrise selbst die Verfügbarkeit und Effizienz von Energiequellen beeinträchtigen, wie etwa durch anhaltende Dürren, die die Leistung von Wasserkraftwerken mindern können. Eine nachhaltige Energiepolitik berücksichtigt daher die Auswirkungen auf das Klima und strebt nach Lösungen, die sowohl umweltverträglich als auch langfristig tragfähig sind.
Zukunftsweisende Baustoffe müssen nachhaltig, langlebig und ressourcenschonend sein, um Gebäude und Infrastrukturen energieeffizienter zu machen. Ein Beispiel ist Holz, das als Baumaterial nachhaltig ist, wenn es aus lokaler Produktion stammt. Neuartige Betonmischungen mit geringem CO₂-Fußabdruck, recycelter Beton und andere Baustoffe aus Bauschutt sind ebenfalls vielversprechend. Weitere potenziell zukunftsträchtige Baustoffe sind Lehm, Wolle, Hanf und Aerogele als Dämmstoffe.
Diese Frage muss im Einzelfall beantwortet werden. Schweizer Unternehmen mit Tochtergesellschaften etwa in der EU oder den USA sowie Zulieferer müssen im Einklang mit den jeweiligen nationalen Gesetzen agieren. Daher betrifft beispielsweise die EU-Richtlinie zur CSR-Berichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) auch Schweizer Unternehmen. Daneben gibt es zahlreiche internationale Standards wie die Global Reporting Initiative (GRI) oder den UN Global Compact, zu denen sich Schweizer Firmen aus Wettbewerbsgründen freiwillig verpflichten.
Die Wirtschaft spielt eine Schlüsselrolle bei der nachhaltigen Entwicklung, da sie mit ihren Aktivitäten die grösste Hebelwirkung in der Gesellschaft entfaltet. So sind vor allem die Finanzindustrie, Technologie und Beschaffungswesen zentral für die Transformation hin zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem. Dafür braucht man Investoren und Unternehmen, die auf ökologische Produktionsverfahren mit sauberer Energie und effizienter Ressourcennutzung setzen und innovative, umweltfreundliche Produkte herstellen. Dies kann Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen, Armut bekämpfen, unterentwickelte Regionen stärken – und gleichzeitig die Belastung künftiger Generationen mindern.
Der Begriff «klimaneutral» bezieht sich auf die Reduktion und Kompensation von menschengemachten Treibhausgasemissionen wie CO2 oder Methan. Ziel der Klimaneutralität ist ein Netto-Null-Status. Das bedeutet, dass alle entstandenen Emissionen entweder vermieden oder durch verschiedene Massnahmen ausgeglichen werden müssen. Zur Emissionsreduktion tragen unter anderem der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien und eine gesteigerte Energieeffizienz bei.

Die Sustainable Development Goals (SDGs) sind 17 globale Ziele für nachhaltige Entwicklung, vereinbart von den UN-Mitgliedsstaaten in der Agenda 2030. Sie decken Themen wie Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit, Gesundheit, Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser, erneuerbare Energie, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Infrastruktur, Klimaschutz und den Schutz der Ozeane und der Biodiversität ab.

Der Verkehr in der Schweiz ist für 36 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich (Stand 2022), wobei über 90% des Energiebedarfs durch Erdölprodukte gedeckt werden. Besonders belastend ist der motorisierte Individualverkehr; knapp drei Viertel der Fahrzeuge in der Schweiz sind Personenwagen. Nachhaltige Mobilität umfasst Elektroautos, intelligente Verkehrsplanung sowie den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und Velowegen. Prognosen sehen einen Anstieg des Verkehrs bis 2050, weswegen der Bund die Verkehrsinfrastruktur verbessern will.
Biodiversität bezeichnet die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten sowie Ökosystemen in einem bestimmten Gebiet. Diese Vielfalt ist entscheidend für stabile Ökosysteme, welche Nahrungs- und Arzneimittel liefern, das Wasser reinigen und Schutz vor Umweltkatastrophen bereitstellen. Zudem spielen natürliche Ökosysteme eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Klimakrise, indem sie Kohlenstoff speichern und als Schutzbarrieren dienen. Der globale Rückgang der Biodiversität durch den Klimawandel und menschliche Eingriffe gefährdet zahlreiche Arten. Schätzungen zufolge sind eine Million Arten vom Aussterben bedroht. Dieser Verlust hat gravierende Konsequenzen: Biologisch verarmte Ökosysteme sind weniger robust und reagieren empfindlicher auf Störungen wie zum Beispiel auf Veränderungen aufgrund der Klimaerwärmung.
Erneuerbare Energien umfassen nachhaltige Quellen wie Wind, Sonne und Wasserkraft, die im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen entweder unbegrenzt verfügbar oder schnell regenerierbar sind. Im Jahr 2022 stammten etwa 79 Prozent des an Schweizer Haushalte gelieferten Stroms aus erneuerbaren Energien: 65 Prozent aus Wasserkraft und knapp 14 Prozent aus Photovoltaik, Wind, Kleinwasserkraft und Biomasse. Rund 20 Prozent des Stroms kamen aus Kernenergie, während knapp 2 Prozent auf fossile Energieträger entfielen. Da der an Schweizer Steckdosen verfügbare Strom nicht ausschliesslich aus heimischer Produktion stammt, weicht der Produktionsmix in der Schweiz von der durchschnittlichen Zusammensetzung des gelieferten Stroms ab.

Ein Nachhaltigkeitsbericht informiert über Risiken, denen ein Unternehmen ausgesetzt ist, und die Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit auf Mensch und Umwelt. Er muss Massnahmen zur Abhilfe negativer Auswirkungen wie CO₂-Emissionen oder Diskriminierungen darlegen und die Governance-Strukturen des Nachhaltigkeitsmanagements beschreiben. Es gibt verschiedene Formen des Reportings: Klimaberichte, Umweltberichte oder umfassende Nachhaltigkeitsberichte, die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Aspekte abdecken. Diese Berichte können von externen Stellen geprüft werden. Zudem gibt es verschiedene Standards wie GRI, UN Global Compact, Integrated Reporting Framework, CDP und TCFD, die die Berichterstattung leiten. Aktuelle Trends zeigen, dass Nachhaltigkeitsberichterstattung zunehmend als integraler Bestandteil der Geschäftsführung und als wesentlicher Faktor für den Markterfolg betrachtet wird.
Kreislaufwirtschaft, auch «Circular Economy» genannt, zielt darauf ab, Rohstoffe effizient und lange zu nutzen, indem Stoff- und Produktkreisläufe durch langlebiges Design, Wartung, Reparatur, Wiederverwendung und Recycling weitgehend geschlossen werden. Im Gegensatz zum linearen Wirtschaftssystem, bei dem Produkte am Ende weggeworfen werden, reduziert die Kreislaufwirtschaft den Verbrauch von Primärrohstoffen, Emissionen und Abfallmengen. Für Unternehmen eröffnen sich mit diesem System neue Geschäftsmodelle.
Die Schweiz verbraucht jährlich etwa 810'000 Terajoule (225'000 Gigawattstunden) Energie (Stand 2023). Diese stammen hauptsächlich aus Erdölprodukten, Wasser- und Kernkraft sowie aus Erdgas. Die grössten Verbrauchergruppen sind Privathaushalte und der Verkehr, die jeweils ein Drittel des Verbrauchs ausmachen. Industrie und Dienstleistungen sind zusammen für knapp ein Fünftel des Verbrauchs verantwortlich. Trotz eines rückläufigen Energieverbrauchs pro Person seit 1990 ist der Gesamtverbrauch aufgrund der Bevölkerungszunahme gestiegen. Bis 2050 strebt die Schweiz eine Reduktion des Endenergieverbrauchs um 54 Prozent und des Stromverbrauchs pro Person und Jahr um 18 Prozent an.
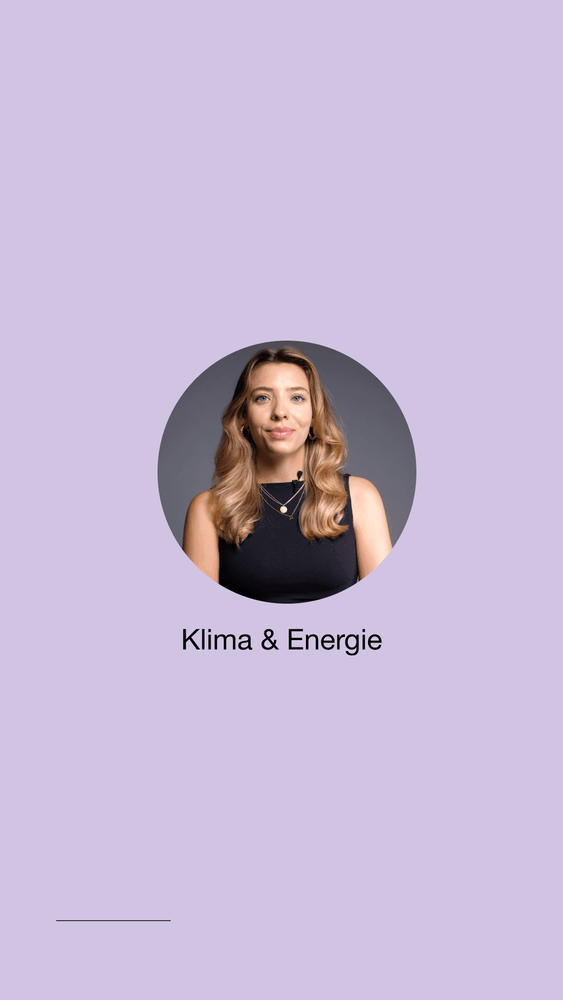
Keine Übereinstimmung mit Ihren Suchbegriffen