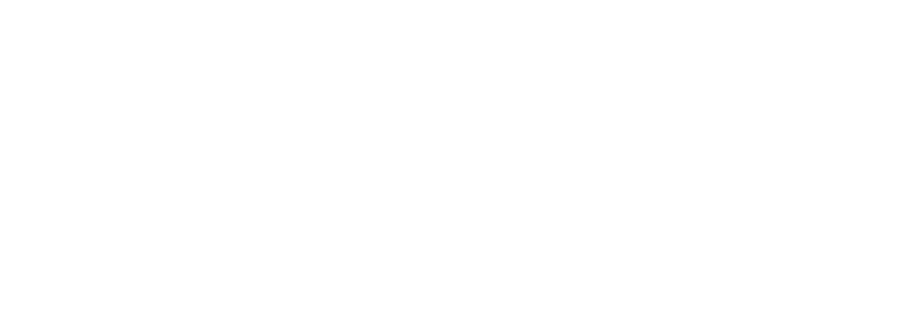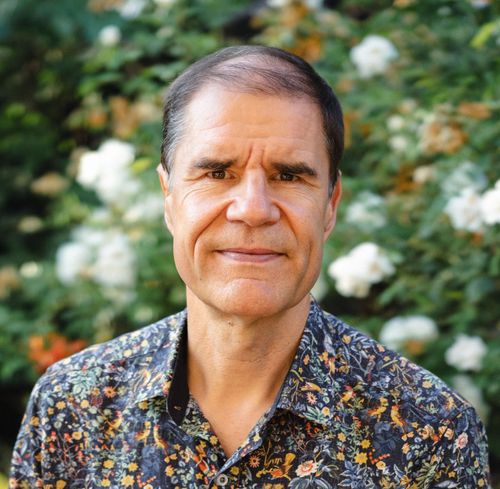Zu Beginn einer Uno-Klimakonferenz schwingen Politiker oft emotional aufgeladene Reden. Damit wollen sie die Bedeutsamkeit der jeweiligen Verhandlungen dramatisieren und Dringlichkeit vermitteln. Das war diese Woche auch in Belém der Fall.
Am Montag begann dort die 30. Ausgabe der jährlichen Klimakonferenz, im politischen Jargon COP30 genannt. «Der Klimawandel ist keine Bedrohung der Zukunft mehr, sondern eine Tragödie der Gegenwart», sagte der brasilianische Präsident Lula da Silva vor den anwesenden Staats- und Regierungschefs. Es sei nun an der Zeit, sich der Realität zu stellen und zu entscheiden, «ob wir den Mut und die Entschlossenheit aufbringen, die für Veränderungen notwendig sind». Er nannte drei Schwerpunkte, an denen der Erfolg der Konferenz wohl am Ende der zweiwöchigen Veranstaltung gemessen werden wird: Fortschritt bei den Emissionsreduktionen, beim Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen und beim Schutz der Wälder.
Die Menschheit sei sich seit mehr als 35 Jahren der Auswirkungen des Klimawandels bewusst, sagte der brasilianische Präsident. Es habe jedoch 28 Konferenzen bedurft, bis 2023 in Dubai «erstmals die Notwendigkeit anerkannt wurde, sich von fossilen Brennstoffen zu verabschieden und die Entwaldung zu stoppen und rückgängig zu machen».
Die Beschleunigung der Energiewende und der Naturschutzbemühungen sei das wirksamste Mittel, um die globale Erwärmung einzudämmen, sagte er. In Belém werden sich die angereisten Diplomaten, Unternehmensvertreter, Forscher und Aktivisten darüber streiten, wie das gelingen könnte – und wer dafür zahlen muss.
Wie es um die globalen Treibhausgasemissionen steht, wie es den Wäldern weltweit geht und wie abhängig wir von den fossilen Brennstoffen sind – alle drei Fragen haben politische Sprengkraft. Die NZZ hat sich mit den jüngsten Daten auseinandergesetzt, um einen Überblick zu schaffen.
Die CO2-Emissionen sinken noch immer nicht
Die weltweiten CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe sind gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen, wenn auch nur wenig.
Sie liegen 2025 schätzungsweise um 1,1 Prozent höher als 2024 und erreichen damit ein Rekordhoch von 38,1 Milliarden Tonnen. Das gaben Forscher des Global Carbon Project am Donnerstag in ihrem jährlichen Bericht bekannt.
In den drei Ländern mit den höchsten Emissionen nahm der CO2-Ausstoss zu: Indien hat jetzt den drittgrössten Ausstoss, noch vor der EU. In China wuchsen die Emissionen um 0,4 Prozent, in den USA um 1,9 Prozent und in Indien um 1,4 Prozent. Die EU hält sich zwar für den Vorreiter im Klimaschutz, aber auch sie legte um 0,4 Prozent zu. Zu dem Anstieg der Emissionen trugen alle drei fossilen Brennstoffe bei. Besonders stark – nämlich um 1,3 Prozent – wuchs der CO2-Ausstoss, der mit der Nutzung von Erdgas zusammenhängt.
Immerhin gibt es in dem Bericht des Global Carbon Project auch gute Neuigkeiten. 35 Länder haben die CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe deutlich gesenkt, obwohl ihre Wirtschaft in den vergangenen zehn Jahren gewachsen ist. Diese Länder sind für fast ein Drittel der fossilen Emissionen im vergangenen Jahrzehnt verantwortlich. Die Dekarbonisierung der Wirtschaft gilt als einer der Schlüssel erfolgreichen Klimaschutzes.
Für die globalen Ziele, die im Pariser Klimaabkommen vereinbart wurden, bedeuten die Emissionszahlen nichts Gutes. 2015 war beschlossen worden, dass die globale Mitteltemperatur deutlich weniger als 2 Grad Celsius über das vorindustrielle Niveau steigen sollte. Im Idealfall sollte sogar eine Erwärmung um 1,5 Grad vermieden werden.
Inzwischen hat sich das extrem ehrgeizige 1,5-Grad-Ziel erledigt: Bleiben die CO2-Emissionen auf dem gegenwärtigen Niveau, ist das Budget für seine Erreichung bereits in vier Jahren aufgebraucht. Auch Vertreter der Uno erkennen diese Tatsache nun in klimapolitischen Reden an. Heute geht es darum, zumindest die 2-Grad-Grenze des Klimaabkommens einzuhalten und in der fernen Zukunft den Temperaturanstieg mithilfe von Technologien wieder unter das 1,5-Grad-Niveau zu senken.
Aber selbst dazu müssten die Emissionen deutlich schneller zurückgehen, als es mit den jüngsten Klimaplänen der Regierungen möglich ist. In der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts müssten sie netto null erreichen. Derzeit geht die Entwicklung aber nicht in diese Richtung. Die Welt läuft gemäss dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen auf eine Erwärmung um rund 2,8 Grad bis 2100 zu. Die Knacknuss bleibt hier die Nutzung fossiler Brennstoffe, die auch in Brasilien wieder auf der Agenda steht.
Die Nutzung der fossilen Brennstoffe nimmt weiterhin zu – wie lange noch, ist unklar
Die Emissionen werden trotz Klimaversprechen durch das Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas womöglich weiter wachsen: Die Internationale Energieagentur (IEA) veröffentlichte am Mittwoch ihren jüngsten Bericht darüber, wie sich die globale Energielandschaft entwickeln könnte.
Die aufsehenerregende Botschaft der IEA: Die Nachfrage nach Erdöl und Erdgas könnte gemäss einem der vier Szenarien noch bis zur Jahrhundertmitte wachsen – und nicht ab den 2030er Jahren abflachen und fallen, wie es die Agentur in den vergangenen Jahren skizziert hatte. In dem pessimistischen Szenario würde die Welt die Klimaziele sprengen und auf eine Erderwärmung von 3 Grad zusteuern. Das hätte extreme Folgen für Menschen, Tiere und die Natur.
Die IEA nahm für dieses Szenario an, dass Regierungen die bestehenden und gesetzlich verankerten Regeln und Vorgaben zum Klimaschutz nicht weiterentwickeln würden. Zudem ging die Agentur davon aus, dass die Hürden für den Ausbau sauberer Technologien hoch blieben. Die Grundannahme sei: Neue Technologien würden langsamer eingeführt, als dies in den vergangenen Jahren zu beobachten gewesen sei. Das betreffe vor allem Elektroautos. Wenn sie sich schnell verbreiten, verringert sich die globale Erdölnachfrage.
Für Vertreter der Industrie der fossilen Brennstoffe, allen voran jene aus den USA, waren die jüngsten Zahlen eine gute Nachricht. Die IEA war während des vergangenen Jahres stark unter Druck durch die Regierung unter Donald Trump geraten. Zum Beispiel hatte der Energieminister Chris Wright die Auffassung als unsinnig abgetan, dass die Erdölnachfrage ab 2030 ihren Höhepunkt erreichen könnte.
In der Vergangenheit lag die IEA immer wieder falsch. So hat sie den Höhenflug der Solarkraft jahrelang unterschätzt. Doch auch bei der Kohle hatte die Agentur zu früh ein Ende der Nachfrage skizziert. Auch in ihrem jüngsten Bericht zeichnet die IEA ein Szenario, in dem die Erdölnachfrage ab der kommenden Dekade abflachen und eventuell fallen könnte. Der Grund für die Annahme: Elektroautos setzen sich weltweit stärker durch. Dabei bezogen sich die Analysten nicht nur auf die bestehenden Massnahmen von Regierungen, sondern auch auf politische Ankündigungen.
Die Zukunft für Erdöl bleibt unklar. Bei Erdgas scheinen sich die Analysten sicherer zu sein: Das Angebot und die Nachfrage wachsen. Der Hauptgrund sei die veränderte Regierungspolitik in den USA, sagte Fatih Birol, der Exekutivdirektor der IEA, am Mittwoch. Sie unterstützt sowohl den Verbrauch als auch den Export. Ein weiterer Grund sei die Erwartung niedriger Gaspreise in den kommenden Jahren.
Welche Klimaziele die Welt noch erreichen kann, hängt entscheidend davon ab, was Politiker in den kommenden Jahren beschliessen werden. Aber nicht nur das. Die IEA zeigt auch, dass die erneuerbaren Energien in allen Szenarien schneller wachsen als jede andere Energiequelle, angeführt von der Solarenergie. Ein Grund dafür: Diese Energiequellen werden immer kostengünstiger. Auch geht die IEA davon aus, dass die Atomenergie in den kommenden Jahren wieder stark wachsen wird.
Was bedeutet das für die Klimaziele und die Verhandlungen in Brasilien? In den kommenden Jahren wird die weltweite Stromnachfrage stark wachsen. Womit Regierungen diesen Bedarf decken, bestimmt die Aussichten für die nächsten zehn Jahre.
Bis 2035 werde der Energieverbrauch vor allem in Regionen wachsen, in denen das Potenzial für die Solarenergie hoch sei, unterstreicht die IEA. Auf welche Klimazukunft die Welt zusteuert, hängt also von den Entscheidungen der Regierungen in Schwellen- und Entwicklungsländern ab.
Die Wende bei der Entwaldung ist noch nicht geschafft
«Auf Länderebene gibt es viele Anzeichen für Fortschritte, darunter ein starkes Wachstum in den Bereichen Solarenergie, Windenergie, Elektrofahrzeuge und Batterien sowie ein Rückgang der Entwaldung», sagt der Klimaforscher Glen Peters vom norwegischen Forschungsinstitut Cicero, einer der Hauptautoren des jüngsten Berichts zu den CO2-Emissions-Daten.
Er hebt damit ein zentrales Thema hervor, vor allem für Brasilien: den Zustand der Wälder.
Die gute Neuigkeit vorweg: Die Entwaldung hat sich gemäss einem Uno-Bericht vom Oktober im vergangenen Jahrzehnt in allen Regionen der Welt verlangsamt. Das ist ein Fortschritt, bedeutet aber längst noch nicht das Ende der Entwaldung überhaupt.
Heute bedecken Wälder mehr als 4 Milliarden Hektaren Land – das ist rund ein Drittel der Landfläche der Erde. Die Hälfte der weltweiten Waldfläche befindet sich in nur fünf Ländern: Russland, Brasilien, Kanada, USA und China. Fast die Hälfte aller Wälder stehen in den Tropen – das ist einer der Gründe, weshalb Brasilien Belém als Austragungsort für die diesjährige Konferenz gewählt hat.
Die Uno-Daten zeigen, dass jedes Jahr netto mehr Wald verlorengeht als neu hinzukommt. Zwischen 2015 und 2025 wuchs der Waldbestand um 6,8 Millionen Hektaren, gleichzeitig gingen 10,9 Millionen Hektaren Wald verloren.
An der COP30 steht vor allem der Schutz des Tropenwalds im Mittelpunkt. Vor wenigen Tagen verkündeten die Gastgeber die Schaffung eines neuen Fonds. Er soll mithilfe privater Geldgeber finanzielle Anreize gegen die Entwaldung schaffen. Einige Regierungen, darunter die norwegische und die portugiesische, haben finanzielle Unterstützung in Milliardenhöhe versprochen. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die brasilianische Regierung ihr Ziel von 10 Milliarden Dollar erreichen wird. Der Fonds ist aber nur ein Puzzleteil in den globalen Bemühungen, die Entwaldung zu bremsen und rückgängig zu machen.
Mehr Klimaschutz würde dabei helfen. Denn Trockenheit und Hitze setzen den Wäldern weltweit zu. Die jüngsten Daten zeigen, dass nicht nur die Landwirtschaft schuld an der Entwaldung ist. Zunehmend werden Waldbrände zum Problem. Im vergangenen Jahr waren sie laut einem Bericht von Global Forest Watch der Hauptgrund für die Entwaldung in den Tropen – und das zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen.