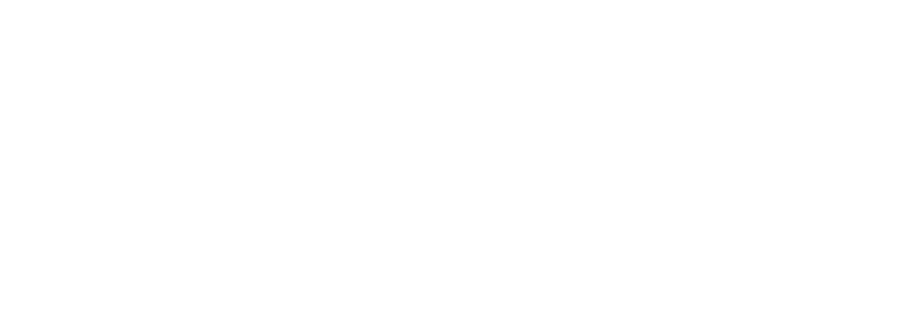Luxusuhren – damit kennt sich Sebastian Lanz ziemlich gut aus. Viele Jahre machte er als Angestellter Marketing für die hochpreisigen Hingucker am Handgelenk. Heute führt der 46-Jährige seine eigene Firma in einem ganz anderen Sektor: Als Chef von RRRevolve verkauft er nachhaltige Mode, vor allem online, aber auch in vier Stores in Zürich und Bern. Die drei «R» stehen dabei für die Nachhaltigkeitsprinzipien Re-Use (wiederverwenden), Reduce (reduzieren) und Recycle (wiederverwerten).
Für Pia Tschannen begann der Weg in Richtung Unternehmertum ganz anders: in der Forschung an der Universität Bern. Bereits in ihrer Diplomarbeit im Fach Sozialgeografie beschäftigte sie sich mit prekären Arbeitsverhältnissen in der Reinigungsbranche. Heute führt sie in Bern zusammen mit Hansjürg Geissler das Unternehmen «Fairness at Work» mit 350 Mitarbeitenden und insgesamt 115 Vollzeitstellen. Gemeinsam schaffen sie mit ihren Vermittlungs- und Beratungsleistungen faire und legale Arbeitsplätze, unter anderem im Tieflohnsektor der Haushaltshilfen. Vor allem junge Berufstätige und Familien, die Reinigungskräfte suchen, nehmen ihr nachhaltiges Angebot in Anspruch – nach dem Motto «Buy social».
Unternehmerinnen sind hier in der Mehrheit
Und weil Social Economy als weiblich gilt, sei noch eine weitere Sozialunternehmerin erwähnt: Muriel Hendrichs. Sie gründete 2015 «L’Alberoteca» im Tessin. Die Ethnobotanikerin wollte sich für den Erhalt bedrohter Arten in der italienischsprachigen Schweiz einsetzen. Daraus wurde rasch mehr. Heute bietet L’Alberoteca Beratung zur biodiversen Landschaftsgestaltung sowie Umweltbildung in Kooperation mit lokalen Organisationen an. Apropos weiblich: Nach Angaben von SENS, der Dachorganisation der Social Economy in der Schweiz, liegt der Frauenanteil in der Chefetage von Sozialunternehmen hierzulande bei stolzen 51 Prozent. Die entsprechende Dachorganisation in Deutschland veröffentlichte in ihrem jüngsten Monitor, dass jedes zweite Sozialunternehmen von einer Frau gegründet werde.
So unterschiedlich Ziele und Zugänge zur sogenannten Social Entrepreneurship beziehungsweise Social Economy sein mögen, so haben sie doch alle eines gemeinsam: Am Anfang steht immer der Wunsch, etwas zu tun, das erfüllt und Sinn stiftet. «Ich wollte mich schon lange selbständig machen und habe zunächst mit dem Verkauf von nachhaltigen Accessoires und Einrichtungsgegenständen angefangen. Aber vor allem wollte ich etwas Sinnvolles tun, so bin ich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen und damit zur nachhaltigen Fashion», erzählt Sebastian Lanz.
Was Social Entrepreneurship bedeutet, ist in der Schweiz rechtlich nicht definiert. Doch in Anlehnung an Rahmenwerke der OECD, der EU und des Forschungsnetzwerks EMES zum Thema Sozialunternehmen gibt es zentrale Merkmale und Prinzipien. Sie grenzen die Branche zum einen gegenüber der Gesamtwirtschaft ab und zum anderen gegenüber Ehrenamt und einem geförderten Sozialsektor. Nicht immer ist die Abgrenzung ganz trennscharf.
Im Zentrum steht jedoch der Wille, eine positive gesamtgesellschaftliche Wirkung mit oftmals innovativen Geschäftsmodellen zu erzielen, um Lösungen für grosse gesellschaftliche Herausforderungen wie den Klimawandel, die Alterung der Gesellschaft, Mobilität und Verteilungsgerechtigkeit zu entwickeln. Es geht also um das «Mindset», die Wertorientierung der Gründerin oder des Gründers, wie Rahel Pfister sagt, die Geschäftsführerin von SENS in Zürich.
Doch mit dem richtigen Bewusstsein allein ist es nicht getan. Denn Sozialunternehmen sind letztlich Unternehmen und beruhen – anders als karitative Organisationen – darauf, dass sie mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes mit eigenen Produkten oder Dienstleistungen erwirtschaften. Die reine Gewinnmaximierung steht jedoch nicht im Vordergrund, vielmehr verfolgen sie eine sogenannte Social Mission. Deren Ziel ist es, soziale, kulturelle oder ökologische Wirkung, kurz: Impact, zu erzielen. «Das Geschäftsmodell muss also mit der Wirkungslogik verzahnt sein», erklärt Rahel Pfister, Geschäftsführerin von SENS in Zürich.
Allfällige Gewinne werden in die Weiterentwicklung der Organisation und zur Stärkung des sozialen Ziels reinvestiert, was in der Wirtschaftspraxis oft zu Diskussionen führt. Ein weiteres nachhaltiges Grundprinzip charakterisiert Sozialunternehmen: eine gute Governance. Das bedeutet, dass die Mitarbeitenden partizipieren können und die Organisation als Unternehmen unabhängig von Dritten entscheidet.
Ohne Business-Know-how geht es nicht
Klingt anspruchsvoll – und das ist es wohl auch. Was braucht man also, um Sozialunternehmerin oder -unternehmer zu werden? Muss man dazu geboren sein oder kann man alles erlernen? So viel ist gewiss: Ohne Grundkenntnisse in Betriebswirtschaftslehre (BWL) geht es nicht. In diesem Punkt unterscheiden sich die Anforderungen an angehende Sozialunternehmerinnen und -unternehmer in keiner Weise von Gründerinnen und Gründern herkömmlicher Startups. Businesspläne mit Angaben zu Produkten und Märkten, Innovation, Finanzen, Personal und Leadership, IT, Beschaffung, Marketing und Vertrieb – klassische BWL-Themen sind auch für die Social Economy von grosser Bedeutung. Sebastian Lanz kannte die freie Wirtschaft aus der Uhrenindustrie. Und bei Pia Tschannen ergänzten sich beim Start ihr wissenschaftlicher Background und das Knowhow ihres Partners Hansjürg Geissler ideal. Doch der Teufel steckt wie immer im Detail – auch in unzulänglichen politischen Rahmenbedingungen für die Branche in der Schweiz.