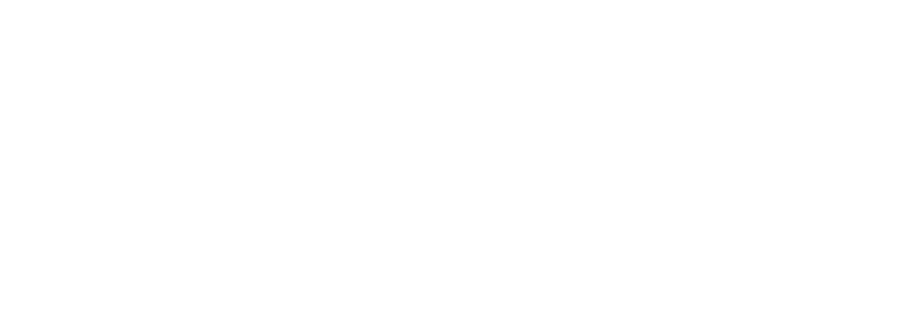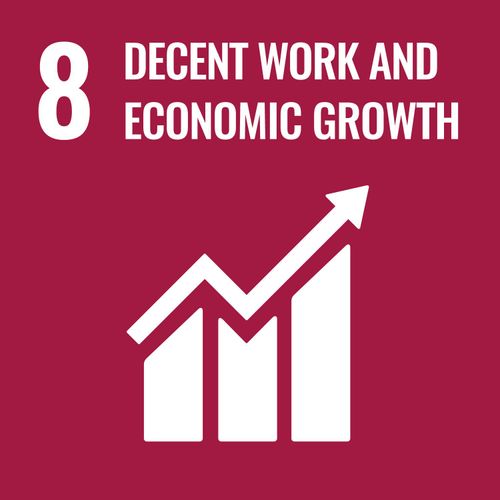Die Schweiz setzt seit Jahren auf Klimaprojekte im Ausland, um die eigenen Emissionen wettzumachen. Jetzt überlegt sich auch Brüssel, mittels internationaler Emissionszertifikate die EU-Klimaziele zu erreichen. Die Schweiz gerät dafür regelmässig in die Kritik. Nun trifft es die EU.
Der Auslöser dieser Debatte ist das geplante Klimaziel für 2040, das die EU-Kommission Anfang Juli vorstellen möchte. Seit Jahren verhandeln Beamte in Hinterzimmern über die geplanten Emissionsreduktionen auf dem Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2050. Nun hoffen sie, mit einem politischen Kompromiss die Unterstützung von Regierungen zu erhalten.
Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dabei immer wieder ein Ziel von 90 Prozent in Aussicht gestellt. Das wird auch von einem Expertengremium für Klimafragen und Aktivisten unterstützt.
Regierungen bremsen Klimaziele
Das Problem: Viele EU-Regierungen unterstützen dieses Ziel gar nicht. Im Gegenteil. Sie sorgen sich um die Kosten für Industrie, Landwirtschaft und andere Wirtschaftssektoren, wo Emissionsreduktionen nur sehr aufwendig und teuer zu schaffen sind. Der politische Widerstand ist nicht überraschend. Vielerorts in Europa wächst die Kritik an den Klimazielen, vor allem in Ländern, wo konservative Parteien jüngst die Wahlen gewonnen haben.
Gleichzeitig erhöhen der sich zuspitzende Handelskrieg mit den USA, geopolitische Spannungen mit China und klamme Staatshaushalte den Druck auf das politische Establishment in Brüssel. Der Widerstand gegenüber den grünen Ambitionen ist dabei zunehmend ein Problem für den selbsternannten Klimaweltmeister. Er zwingt EU-Politiker und Beamte, die geplanten Auflagen angesichts der benötigten Investitionen und möglichen gesellschaftspolitischen Verwerfungen gegen andere politische Prioritäten abzuwägen – und gegebenenfalls auch aufzuweichen.
Brüssel hofft nun entsprechend, mit einem Kompromiss die Unterstützung von EU-Regierungen zu erhalten. So plant Wopke Hoekstra, der niederländische Klimakommissar, künftig auch Gutschriften aus ausländischen Klimaprojekten zuzulassen, wo Emissionen kostengünstiger reduziert werden können. Das sagt Peter Liese, ein deutscher Europaabgeordneter der CDU, im Gespräch. Er ist mit den Plänen vertraut.
Liese sagt, ohne solche Flexibilitäten werde es keine Unterstützung für ein neues Emissionsziel von 90 Prozent geben. Und auch mit einer solchen klimapolitischen Krücke werde es schwierig sein, EU-Regierungen dafür zu gewinnen. Das sei auch den Beamten in Brüssel klar. Es gebe deswegen Unterstützung von Ursula von der Leyen und Wopke Hoekstra, beides Vertreter der gleichen konservativen Parteifamilie wie Liese.
Zudem kommt Rückendeckung aus Deutschland, das für den Beschluss neuer Klimaziele ausschlaggebend ist. Denn im Koalitionsvertrag wurde verankert, dass die Regierung ein Klimaziel 2040 nur mit Verwendung von internationalen Emissionszertifikaten unterstützen wird.
Diese Position bricht jedoch mit einem klimapolitischen Leitsatz der EU. Jahrelang hatten sich Europapolitiker und Kommissionsbeamte gegen die Anrechnung von eingesparten Emissionen im Ausland gestemmt. Zu gross war die Sorge, dass die Klimaziele aufgrund unglaubwürdiger Projekte im Ausland untergraben werden würden. Schon in den 2000er Jahren hatte die EU schlechte Erfahrungen mit internationalen Emissionszertifikaten gemacht, insbesondere durch Projekte in China, die vorgegeben hatten, Industriegase zu zerstören. Daraufhin wurde 2013 ihre Verwendung für die europäischen Klimaziele verboten.
EU-Aktivisten und Forscher schlagen Alarm
Nun wächst der Widerstand erneut. Der unabhängige Beirat in Klimafragen mahnte vergangene Woche, dass ein Reduktionsziel von 90–95 Prozent für das Jahr 2040 sowohl erreichbar als auch in Europas eigenem strategischem Interesse sei – aber bloss nicht, indem man sich auf internationale Emissionsgutschriften verlasse! Die Forscher sagen, es bestehe die Gefahr, «dass dadurch Mittel von inländischen Investitionen abgezogen und die Integrität der Klimaziele untergraben werden könnte».
Die Schweiz ist mit solchen Kritikpunkten seit Jahren vertraut. Regelmässig wird sie für ihre Politik gerügt, die stark auf CO2-Einsparungen im Ausland setzt. Rund ein Drittel der gesamten Emissionsreduktion soll bis 2030 mit solchen Kompensationen erzielt werden. Die Schweiz ist damit auch einer der grössten Akteure in einem neuen internationalen Emissionsmarkt, der vergangenes Jahr im Rahmen des Pariser Klimaabkommens beschlossen wurde.
Auf Vanuatu werden Solaranlagen gebaut, Elektrobusse in Thailand finanziert und Holzsparkocher in Afrika gefördert. In den vergangenen Monaten haben Schweizer Politiker weitere Verträge unterschrieben, unter anderem um Elektrofahrräder in Ghana zu finanzieren.
Aber diese Projekte werden regelmässig von NGO angeprangert. Ende vergangenen Jahres etwa wies die Alliance Sud in einer Recherche warnend darauf hin, dass ein Kochofenprojekt in Ghana die geplanten Emissionsreduktionen weit überschätze. In einem Bericht von Radio SRF räumte auch die Stiftung Klimaschutz und CO2‑Kompensation (Klik) ein, dass der Wert der Emissionsreduktionen zu hoch liege. Die Organisation kauft für die Erdölimporteure die Kompensationen ein. Man rechne mit weitaus niedrigeren Emissionsreduktionen, hiess es in einer Stellungnahme.