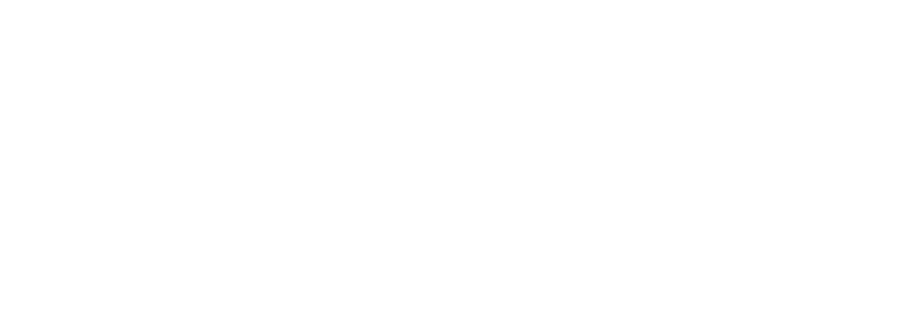In den letzten Jahrzehnten haben sich Risikokapitalinvestitionen in der Schweiz von einer Nischenaktivität zu einer anerkannten Anlageklasse entwickelt. Diese Entwicklung spiegelt sowohl die zunehmende Reife des Innovationsökosystems – geprägt von Institutionen wie der ETH Zürich und der EPFL – als auch das wachsende Interesse institutioneller Investoren an Chancen mit hohem Wachstumspotenzial wider.
Das Venture-Capital-Modell ist im Prinzip einfach erklärbar: Investoren stellen jungen Unternehmen Kapital zur Verfügung. Diese sollen schnell wachsen und zu einem späteren Zeitpunkt verkauft, fusioniert oder an die Börse gebracht werden. Anders als bei traditionellen Finanzierungsinstrumenten, welche auf stabile Renditen setzen, soll Venture Capital die Weiterentwicklung und Skalierung beschleunigen und die Lücke zwischen Forschung und Markteinführung schliessen. Dieser Ansatz war bereits entscheidend für die Entstehung ganzer Branchen und ermöglichte technologische Durchbrüche, die ansonsten möglicherweise in Forschungslabors stecken geblieben wären.
Bis heute entwickelt ein erheblicher Teil der durch Risikokapital finanzierten Unternehmen Technologien, die darauf abzielen, positive Wirkungen zu erzielen. Einige setzen unmittelbar auf Nachhaltigkeit, beispielsweise durch CO₂-Abscheidung, erneuerbare Energien oder Lösungen für die Kreislaufwirtschaft, während andere indirekt durch Effizienzsteigerungen in Bereichen wie KI, Automatisierung oder fortschrittliche Werkstoffe dazu beitragen. Durch die Mobilisierung von Kapital und Fachwissen spielt Venture Capital eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung dieser Lösungsansätze und trägt dazu bei, die dringenden Herausforderungen der heutigen Zeit zu bewältigen.
Kurzfristdruck vs. langfristige Mission
Allerdings beinhaltet das Modell auch gewisse Schwierigkeiten. Venture-Capital-Fonds sind auf die Erwartung finanzieller Renditen innerhalb definierter Zeiträume ausgerichtet, die häufig bei etwa zehn Jahren liegen. Selbst nachhaltigkeitsorientierte Fonds sehen sich mit denselben Erwartungen hinsichtlich einer starken finanziellen Performance konfrontiert. Dieser doppelte Druck führt zu einer strukturellen Fehlausrichtung, welche zu Verzerrungen führen kann, etwa wenn Exit-Entscheidungen mit dem Unternehmensziel kollidieren.
Governance-Instrumente helfen, diese Reibungen zu mindern und die Interessen aller Stakeholder in Einklang zu bringen. Zu den wichtigsten Massnahmen gehört die Verankerung der Unternehmensmission in den Gründungsdokumenten, wodurch die Nachhaltigkeitsziele für den Vorstand und die Geschäftsführung verbindlich werden.
Anreizstrukturen wie Kapitalbeteiligungen oder Bonussysteme können so gestaltet werden, dass das Management nicht nur für finanzielle Ergebnisse, sondern auch für messbare Nachhaltigkeitskennzahlen belohnt wird. Dazu gehören beispielsweise vermiedene CO₂-Emissionen, Recyclingquoten oder der reduzierte Wasserverbrauch.
Governance in der Praxis
Auf Investorenseite experimentieren einige Fonds mit solchen Anreizstrukturen, sogenannten «Impact Carry». Dabei hängt ein Teil der Performance-Gebühr davon ab, ob neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitskennzahlen im Portfolio erreicht werden.
Aktionärsvereinbarungen können zudem Bestimmungen enthalten, die den Austausch von Investoren zulassen, wenn sich deren Zeitplanung nicht mit dem Geschäftszweck vereinbaren lässt. In der Praxis kann dies Möglichkeiten eröffnen, zusätzlich Liquidität zu schaffen. Etwa durch die Aufhebung von Übertragungsbeschränkungen womit Sekundärtransaktionen ermöglicht werden oder durch die Gewährung von Put-Optionen zu einem vereinbarten Preis. Investoren können aussteigen, ohne die strategische Ausrichtung zu gefährden.
Bei sorgfältiger Abstimmung tragen diese Governance-Massnahmen dazu bei, den strategischen Fokus zu bewahren und das Risiko von unpassenden oder falsch abgestimmten Ausstiegen zu verringern, die die langfristigen Ziele des Unternehmens untergraben könnten.
Für die Investoren bieten solche Rahmenbedingungen die Gewissheit, dass Nachhaltigkeitsziele nicht vernachlässigt werden. Für die Gründer bieten sie Schutz vor kurzfristigem Druck. Für die Gesellschaft erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, dass transformative Technologien wachsen und ihrem Zweck treu bleiben können.