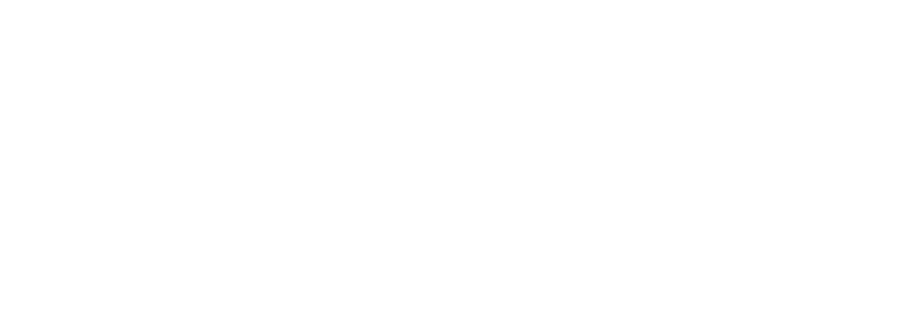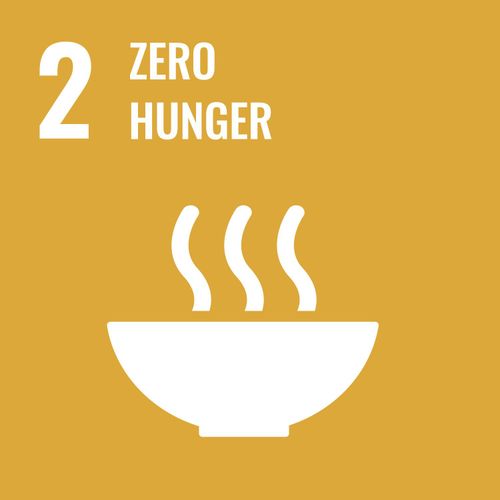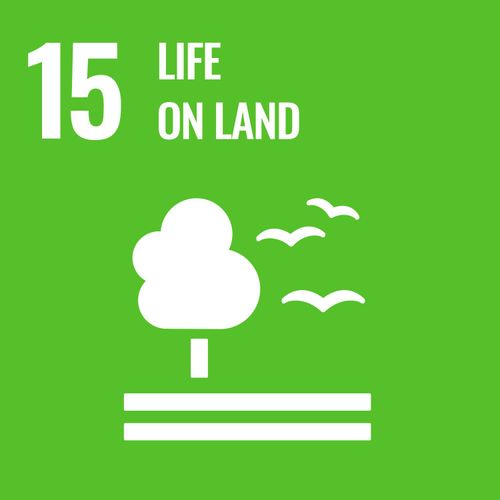Den Sahel, diese Region am südlichen Rand der Sahara, zwischen Wüste und Savanne, verbindet man mit Elend. Die Nachrichten dominieren Hungersnöte, Terrorismus und Krieg. Fast 100 Millionen Menschen leben in dem 6000 Kilometer langen Streifen.
Doch es gibt in der Region auch positiv stimmende Entwicklungen. Noch in den 1980er Jahren machten Dürreperioden Schlagzeilen. Aber seit einigen Jahren nehmen die Regenfälle zu. Die Landschaft wird grüner, und eine wichtige Ursache könnte ausgerechnet der Klimawandel sein. Sogar auf Satellitenbildern ist diese Veränderung zu erkennen.
Ist das eine echte Chance für die Region? Die Fachleute zögern. Die Probleme im Sahel sind so gross, dass die Nutzung des zusätzlichen Regens schwerfallen wird. Trotzdem: Es gibt mehrere Methoden, mit deren Hilfe die Menschen von dem klimatischen Wandel profitieren könnten, etwa mithilfe neuer Pflanzenarten.
In den vergangenen vierzig Jahren haben die Regenfälle in der Region erkennbar zugenommen. Das liegt vor allem daran, dass der Temperaturkontrast zwischen der heissen Wüste und dem kühleren Atlantik gewachsen ist. Je grösser der Temperaturkontrast ist, desto stärker wird der westafrikanische Monsun angefacht und damit der Niederschlag.
Für die Zukunft prognostizierten Klimamodelle zwar unterschiedlich grosse Mengen, sagt der Klimaforscher Paul-Arthur Monerie von der University of Reading in England. Im Durchschnitt werde aber eine weitere Zunahme der Regenfälle erwartet. Nur im äussersten Westen des Sahels könne der Niederschlag zurückgehen.
Mehrere Studien zeigen, dass vor allem die heftigsten Regengüsse zunehmen werden. Ausserdem werde sich der westafrikanische Monsun verschieben, sagt Monerie, möglicherweise werde er in Zukunft eine Woche später zu Ende gehen. Beide Entwicklungen sind für Landwirte sehr bedeutsam, weil sie unter Umständen die Zeitpunkte für Aussaat und Ernte verschieben müssen.
Für die Bauern ist die Regenzeit entscheidend
Die Landwirtschaft im Sahel basiert im Wesentlichen auf der Regenmenge, die innerhalb einer Saison fällt. Der Boden ist sandig, Wasser versickert schnell, und es gibt kaum natürliche Wasserreservoire. Nur wenige Flächen können bewässert werden.
Im Sahel werde darum immer mit grosser Spannung darauf gewartet, ob der Regen komme, wann er komme und wie er wandere, berichtet der Geograf Martin Brandt von der Universität Kopenhagen. «Die Menschen hängen stark davon ab.»
Wann der Regen einsetze, sei in der Wahrnehmung der Menschen unsicherer geworden. Komme er zu früh und bleibe es anschliessend eine Weile trocken, vertrockneten die Felder wieder – und wenn es später wieder regne, könne die Landwirtschaft davon nicht mehr profitieren. Die Menschen im Sahel hätten ziemlich viel Angst davor, dass der Regen ungleichmässig falle, sagt Brandt.
Bäume sind hilfreich für den Ackerbau
Um sich für die Zukunft zu wappnen, kommen in der Landwirtschaft eine ganze Reihe von Massnahmen infrage. Nützlich ist es zum Beispiel, Landwirtschaft mit Forstwirtschaft zu kombinieren. Die sogenannten Agroforstsysteme sind in der Region zwar bereits bekannt, aber sie könnten sich in Zukunft als besonders robust gegenüber dem Klimawandel erweisen.
Eine besonders wichtige Rolle spielen Bäume der Art Faidherbia albida. Dieser Baum kann auf Feldern wachsen und liefert selbst dann Produkte, wenn die Ernte einmal schlechter ausfällt – neben den Früchten und Samen lassen sich auch die Rinde und die Wurzeln verwerten.
«Der Faidherbia albida ist ein richtiger Wunderbaum», sagt Brandt. Zur Regenzeit trage er keine Blätter. Wenn es regnet und Hirse oder eine andere Pflanze auf dem Feld wächst, wird der Regen nicht abgeschirmt. Erst in der Trockenzeit spriessen die Blätter. Sie dienen anschliessend als eine Art Dünger für die Felder.
Ausserdem bindet der Baum den wichtigen Nährstoff Stickstoff im Boden. In Niger gebe es Regionen, in denen das Anpflanzen von Faidherbia albida auf den Feldern die Lebensqualität deutlich erhöht habe, so Brandt.
Im Sahel wachsen sogar Mangos
Lisa Murken vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung betont ebenfalls den Nutzen von Agroforstsystemen. Manche Bäume könnten Pflanzen, die diesen Schutz benötigten, Schatten spenden oder sie vor Wind schützen. Sie habe auf Feldern im Sahel sogar schon Cashewbäume oder Mangobäume gesehen. Deren Früchte könnten als zusätzliche Einkommensquelle dienen, sagt die Agrarökonomin.
Projektionen des landwirtschaftlichen Ertrags zeigten für die meisten Kulturpflanzen, die in der Region wichtig seien, eher sinkende Erträge, vor allem wegen der steigenden Temperaturen, erläutert Murken. Umso wichtiger sind angepasste Pflanzenkulturen.
Die gibt es teilweise schon. Ein Beispiel ist die Foniohirse, eine der ältesten afrikanischen Getreidearten, die auch als Hungerhirse bekannt ist. «Diese Hirseart enthält viele wertvolle Nährstoffe», sagt Murken. In einigen Teilen des Sahels sei sie sehr beliebt und zum Beispiel resistenter als Perlhirse oder Sorghum.
Optimiertes Saatgut ist eine weitere wichtige Lösung für die Zukunft. Für den Sahel seien bereits verbesserte Sorten gezüchtet worden, vor allem bei Mais und Reis, sagt Murken. Sie sind hitzeresistenter, tolerieren längere Trockenphasen oder halten heftigere Regenfälle aus. Aber in diesem Bereich müsse noch deutlich mehr gemacht werden, findet sie.
Halbmonde im Boden speichern Regenwasser
Wichtig ist natürlich, das kostbare Regenwasser aufzufangen und für die Landwirtschaft zu speichern. Dafür eignen sich traditionelle Techniken; die Entwicklungsökonomin Jenny Aker von der Tufts University bei Boston erläutert eine Anbautechnik, bei der halbmondförmige Vertiefungen in den Boden gegraben werden: In den sogenannten «demi-lunes» könne sich das Regenwasser sammeln. Das verringere auch die Erosion.
Regnet es stark, wird die oberste Bodenschicht weggewaschen, aber sie sammelt sich zusammen mit dem Regenwasser in den Vertiefungen. Wird es später wieder trocken, bleibt der Boden in den «demi-lunes» länger feucht. Darum eignen sie sich so gut für den Pflanzenanbau.
In vielen Teilen des Sahels praktizieren Bauern diese Technik schon lange, mancherorts seit Jahrhunderten. Dennoch lohnen sich Schulungen, um die Anwendung zu optimieren. Wenn es sehr heftig regne und extreme Überflutungen gebe, helfe die Technik allerdings nicht, sagt Aker. Dann müsse man andere Pflanzen anbauen als Hirse oder Sorghum – Reis zum Beispiel.
Die Agropastoralisten im Norden haben schlechte Karten
Der französische Agronom Pierre Hiernaux hat den Sahel über mehrere Jahrzehnte bereist und erforscht. Entsprechend gut kennt er die Verhältnisse vor Ort. Der unabhängige Agrarberater betont, wie wichtig der Zusammenhang zwischen der Viehhaltung und den Nährstoffen für den Boden sei – auch im Hinblick auf den Klimawandel.
Vielerorts sei der landwirtschaftliche Ertrag im Sahel durch den Mangel an Stickstoff und Phosphor im Boden begrenzt, sagt Hiernaux. Darum habe es eine lange Tradition, den Mist von Viehherden für die Düngung von Getreidefeldern zu nutzen. Doch der Einsatz des Dungs sei durch die Herdengrösse limitiert. Mineralischer Dünger als Ersatz sei für die Bauern meist zu teuer.
Eine wichtige Rolle kommt laut Hiernaux den Bauern im trockenen Norden des Sahels zu, die sowohl Viehhaltung als auch Landwirtschaft betreiben. Viele Familien dort treiben Viehherden in der Regenzeit zum Weiden auf nährstoffreiche grüne Flecken am Rande der Sahara, während andere Mitglieder der Familie weiter im Süden die Äcker bestellen. In der Trockenheit kehren die Herden nach Süden zurück. Sie ernähren sich dort von Ernteresten und übrig gebliebenem Savannengras. Ausserdem bringen sie Dung auf die Felder.
Grundsätzlich könnte diese Kombination aus Viehhaltung und Getreideanbau von zusätzlichem Regen profitieren. Doch der sogenannte Agropastoralismus ist durch die gesellschaftlichen Veränderungen und Konflikte in vielen Sahelländern bedroht.
Die Bevölkerung nimmt zu, und dadurch wachsen nicht nur die Städte, sondern auch die Dörfer. In der Folge werden die Ackerflächen rings um die Dörfer immer grösser. «Diese Entwicklung lässt fast keinen Raum mehr für Weideland», sagt Hiernaux. Die Agropastoralisten würden zwischen der Wüste im Norden und den Ackerflächen im Süden eingequetscht.
Ein grundsätzliches Hindernis für eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel ist und bleibt die anhaltende Armut der Bauern in der Region. Sie könnten nicht viel investieren, sagt Hiernaux. «Sie haben keine Hemmungen, neue Technologien zu nutzen, viele verwenden zum Beispiel Handys, um ihre Produkte zu vermarkten, aber sie haben einfach nicht die Mittel für den Erwerb neuer Technologien.»
Eine Intensivierung der Landwirtschaft, die der zusätzliche Regen unter Umständen ermöglichen könnte, bleibt für die Menschen im Sahel darum vorerst ein Traum.