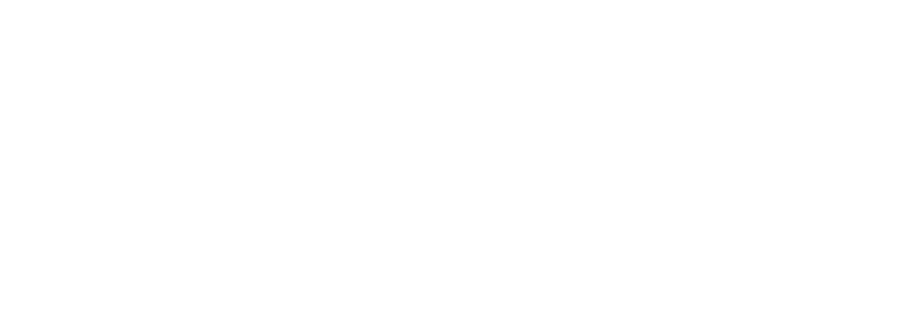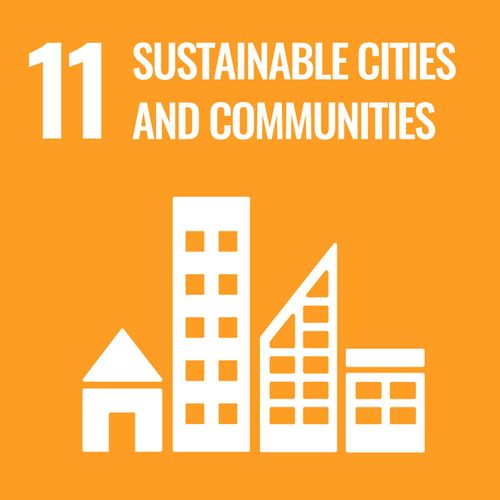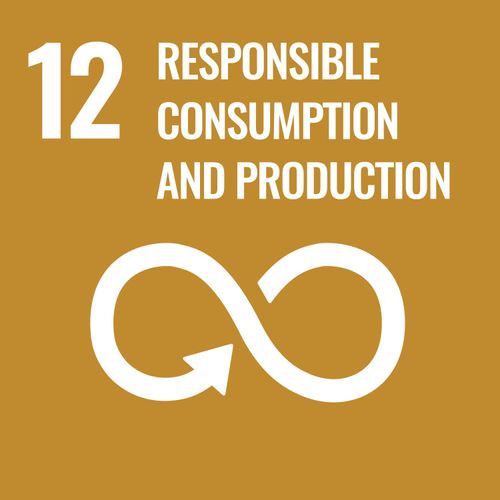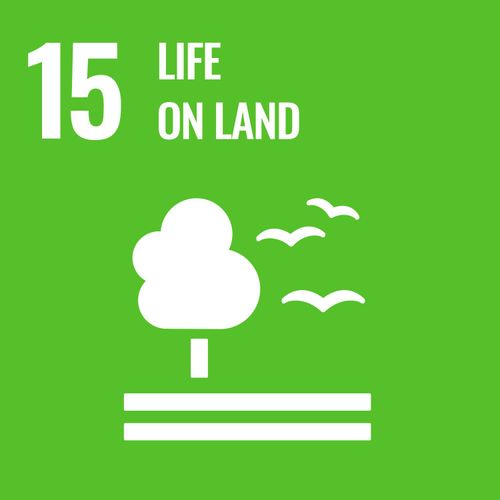Kaum eine Umweltschutzidee inspirierte in den letzten Jahren so sehr wie diese: Bäume pflanzen, um den Klimawandel zu bremsen, dem Verfall biologischer Vielfalt entgegenzuwirken und das Wohlergehen von Menschen zu fördern. Auf Bäume konnten sich alle einigen, Umweltschützer und Industrie. Sogar US-Präsident Donald Trump pflanzte einen Baum gegen den Klimawandel.
Dass Wälder wachsen können, ohne dass die Landwirtschaft leidet, zeigen Europa und Nordamerika. Dort werden Wälder seit Jahrzehnten grösser. Das soll überall möglich sein. Wälder sind Teil der internationalen Klimaziele. Programme wie die Bonn Challenge riefen zur Renaturierung von 350 Millionen Hektaren Land auf, die Billion Tree Campaign der Uno zur Pflanzung von einer Milliarde Bäume.
Doch wie viel grösser der Wald weltweit noch werden könnte, ohne dass der Ackerbau und andere Ökosysteme gefährdet werden, löste kontroverse wissenschaftliche Diskussionen aus. Im Zentrum stand eine Studie der ETH Zürich von 2019. Sie sagte: eine Fläche, so gross wie die USA. Andere Berechnungen kamen auf kleinere Zahlen. Nun fasst eine Studie in «Nature Communications» die Forschung zusammen und versucht, ein realistischeres Bild zu zeichnen.
«Die Forschung, die viel Aufmerksamkeit in den Medien und in internationalen Polit-Kreisen erhielt, war nicht wirklich repräsentativ für die Diskussion unter Fachleuten», sagt Forrest Fleischman, Politikwissenschafter und Wald-Spezialist an der Universität von Minnesota und profilierter Kritiker des Baumpflanz-Hypes.
Dass es bei Wäldern zwei Realitäten gibt, sei ihm zum ersten Mal vor zehn Jahren aufgefallen. Damals publizierte das World Resources Institute, ein renommierter Umwelt-Think-Tank aus den USA, einen pixeligen Atlas für mögliche Aufforstung. Fleischman kam die Weltkarte seltsam vor. Das Institut zeichnete etwa Savannen als mögliche Gebiete für Aufforstung ein. «Afrikanische Savannen existieren seit Millionen Jahren», sagt Fleischman: «Sie haben bioklimatische Bedingungen, unter denen Bäume wachsen können. Aber die Tiere in diesen ikonischen Landschaften, wie Löwen und Giraffen, sind keine Waldtiere.»
Ein Drittel des menschengemachten CO2 kompensieren
Doch das war erst der Anfang. Vorschub erhielt die Forschung auch durch eine rasante technologische Entwicklung. Die Zahl der Satelliten im Weltall hatte sich seit 2010 fast verzehnfacht. Entsprechend viel besser wurden die Daten über unseren Planeten. Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz erlaubten es, unterschiedliche Vegetationen maschinell zu kategorisieren: Was ist Wald, was war mal Wald, was könnte wieder Wald werden. Die bereits erwähnte ETH-Studie machte 2019 genau das: Der Biologe Thomas Crowther und sein Team versuchten zu ermitteln, wie viel Wald auf der Welt noch Platz hat. Damals war Crowther noch an der ETH Zürich angestellt, inzwischen musste er die Hochschule aber nach Vorwürfen der Belästigung verlassen, die der Forscher zum Teil bestreitet.
Das Geld für die Forschung half Plant for the Planet aufzutreiben, eine NGO mit dem Ziel, eine Billion Bäume auf der Welt zu pflanzen. Ein Drittel der menschengemachten CO2-Emissionen könnte so kompensiert werden, rechnete die ETH-Studie vor. Das Ergebnis ging um die Welt. Greta Thunberg drehte ein virales Video über die «magische Maschine» Bäume. Trump pflanzte eine dieser Maschinen und rief ebenfalls zur Pflanzung einer Billion weiterer auf. Unternehmen erhofften sich von Bäumen einen einfachen Weg, Emissionen zu kompensieren.