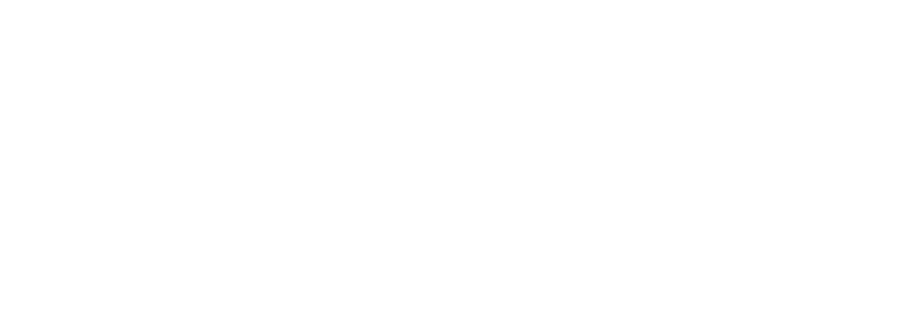Stellen Sie sich vor, Sie kochen eine Lasagne. Schicht für Schicht fügen Sie die Zutaten hinzu: Hackfleisch, Käse, Pasta – ein Fest für den Gaumen. Doch schon bevor der erste Bissen genommen ist, hat dieses Gericht in der Lieferkette einen beachtlichen CO₂-Fussabdruck hinterlassen. Was wäre aber, wenn Sie die Rezeptur ändern könnten – nicht geschmacklich, sondern klimatisch? Weniger Rindfleisch, dafür mehr Pilze – kaum ein Unterschied auf der Zunge, aber ein grosser bei den Emissionen.
Ob Lasagne, Elektronik oder Maschinen: Der Blick auf die Lieferkette bietet den Unternehmen ein riesiges Einsparpotenzial. Schliesslich fallen hier bis zu 90 Prozent der Emissionen an. Eine detaillierte CO₂-Analyse unter Einsatz von Daten und smarten Softwarelösungen hilft den Firmen, ihre Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig Effizienzgewinne sowie Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitbewerbern zu erzielen – ohne das Endprodukt zu verfälschen.
Vorteile im Wettbewerb
Dies gilt für sämtliche Firmen, stellt aber insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor die Herausforderung, ihre Einsparungen konkret zu beziffern. Mehr und mehr müssen die Betriebe heute Emissionsvorgaben erfüllen, wollen sie am Markt als Zulieferfirmen von anderen Unternehmen in Erscheinung treten. Gefragt sind dann – vielfach von den Grosskunden, die ihre eigene Supply-Chain optimieren wollen – entsprechende Dokumente und Belege, welche die Reduktionsbemühungen der Zulieferer festhalten. In vielen Fällen sind solche Unterlagen sogar eine Voraussetzung, um überhaupt für die Selektion als Lieferanten zugelassen zu werden. «Sind die Firmen Zulieferer für andere Hersteller, ist die Reduktion der Emissionen ein entscheidendes Argument, um weiterhin oder neu als Lieferant berücksichtigt zu werden», erklärt Res Witschi, Delegierter für nachhaltige Digitalisierung bei Swisscom.
Gleichwohl konzentrieren sich viele Unternehmen nach wie vor hauptsächlich auf ihren eigenen Betrieb: Sollen Emissionen gesenkt werden, versuchen sie es über Anpassungen im eigenen Fahrzeugpark, über den Ausstieg aus fossilen Energiequellen oder über den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. «Ein Blick auf die sogenannten Scope-1- und Scope-2-Emissionen, sprich jenen Ausstoss, der direkt in einem Unternehmen anfällt oder die von einem Betrieb verwendete Energien betrifft, macht natürlich Sinn und sollte in einem ersten Schritt auch priorisiert werden», sagt Witschi. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Lieferkette kommt in der Folge aber oft zu kurz – obwohl die indirekten Emissionen im Normalfall ein viel höheres Reduktionspotenzial aufweisen. «Die eigenen Emissionen bilden einen guten Startpunkt. Wer aber die wirklich grossen Fortschritte erzielen will, muss sich mit der Liefer- und Wertschöpfungskette auseinandersetzen», ergänzt er.
Komplexe Überwachung
Dass die Steuerung der Wertschöpfungskette dennoch weniger Beachtung erfährt, liegt unter anderem an der Komplexität der Aufgabe. Ohne geeignete technologische Unterstützung ist es nicht nur für KMU ein schwieriges Unterfangen, an diesem Hebel anzusetzen und entsprechende Massnahmen zu verwirklichen. Mit weitreichenden Folgen: Viele Initiativen stützen sich unter diesen Umständen eher auf Intuition, als dass tatsächlich gemessene Werte eine solide Basis für Entscheidungen bilden. Die Berechnung der CO₂-Intensität einer Produktion erfolgt dann anhand der getätigten Ausgaben in Franken (sogenanntes Spend-based-Prinzip), ohne dass genauer eruiert wurde, wo die Hebel für die Dekarbonisierung der Rohmaterialien genau liegen. Eine solche Berechnungsmethode ist entsprechend ungenau und fehleranfällig. Dabei wären belastbare Zahlen umso nötiger. «Es ist wichtig, dass sich KMU, insbesondere als Zulieferfirmen von Grossunternehmen, auf verlässliche Angaben stützen können», ergänzt Witschi.