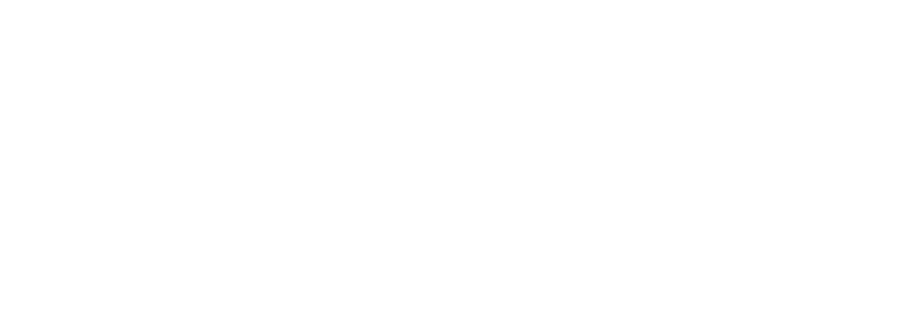Manche alltäglichen Phänomene scheinen kaum der Rede wert: Flüssiges Wasser erhitzt und steigt als Dampf auf. Es verdunstet. Keine grosse Sache, richtig? Für Giulia Tagliabue schon. Sie sieht in der Verdunstung kein Allerweltsphänomen, sondern ein fast unendliches Potenzial – für Anwendungen, die zur nachhaltigen Energieversorgung beitragen sollen.
Tagliabue leitet das Laboratory of Nanoscience for Energy Technology (LNET) an der EPFL und fokussiert dabei auf Nanophotonik. Dieser noch recht junge Forschungsbereich schreitet seit einiger Zeit mit vielen spannenden Resultaten rasant voran. Es geht hier, einfach gesagt, um die Wechselwirkungen von Licht und Materie im Nanometerbereich. Dazu muss man wissen: Wenn Photonen, die kleinsten Einheiten von Licht, auf Teilchen, Drähte oder Oberflächen im Nanomassstab treffen, können neuartige Effekte auftreten. Denn die Materialien verhalten sich im Nanobereich anders als gewohnt. Das macht ihre Interaktionen mit Licht so spannend: Wenn wir diese Effekte verstehen, können wir sie kontrollieren und nutzen, etwa für die Produktion und Speicherung von Energie.
Das Ziel ist klar, der Weg aber trotzdem weit. Ein Nanometer entspricht einem Milliardstel Meter. Auf dieser Skala nimmt selbst ein menschliches Haar mit einem Querschnitt von bis zu 100 000 Nanometern plötzlich riesenhafte Dimensionen an. Das bedeutet, dass die Nanowelt für das blosse Auge unsichtbar und ganz grundsätzlich schwer zu durchdringen ist, aber eben auch viel zu bieten hat.
So kann etwa die Sonnenstrahlung allein den Transfer von Energie im Nanobereich antreiben, was Tagliabue über ihre Forschung nutzbar machen möchte. «Wir müssen dafür aber zuerst die wichtigsten Zusammenhänge verstehen», sagt sie. «Das ist so komplex, weil im Nanobereich viele verschiedene Phänomene gleichzeitig auftreten und ganz unterschiedliche Effekte auslösen. Wir wollen zumindest entschlüsseln, welche jeweils besonders wichtig sind.» Deshalb hat sie sich vor allem der Grundlagenforschung verschrieben. Deshalb sucht sie über die Grenzen ihrer Diszplin hinweg Kooperationspartner, wo in ihrer Gruppe die Expertise oder Ausstattung fehlt.
Wie etwa die Zusammenarbeit mit Modellierern zeigt, ist dieser interdisziplinäre Ansatz ein Erfolgsrezept. «Wir legen unsere Experimente so an, dass wir den Theoretikern sehr saubere Daten liefern können», sagt Tagliabue. «Dafür bekommen wir von ihnen Vorhersagen, um zu testen, ob diese sich mit unseren Ergebnissen decken. Wir erhalten auf dem Weg Informationen, die anderweitig nicht zugänglich gewesen wären.» Informationen, die auch in die drei Forschungsbereiche in Tagliabues Labor einfliessen.
Licht wird «eingefangen»
Ein erster Forschungsbereich, die Plasmonic Catalysis for Photochemical Energy Storage, will chemische Reaktionen über Licht kontrollieren. Ganz allgemein lassen Katalysatoren chemische Prozesse schneller ablaufen – und in der plasmonischen Variante spielt Licht ebenfalls eine Rolle. Die Katalysatoren bestehen meist aus Silber oder Gold in Nanogrösse, weil Metalle wie diese eine wichtige Eigenschaft haben: Sie sind gute Katalysatoren, können aber auch effizient Licht «einfangen » und auf diese Weise viel Energie erzeugen, die dann wiederum chemische Reaktionen starten, beschleunigen und steuern kann. Ein wichtiger Ansatz, weil herkömmliche Katalysen oft unter hohem Druck und hohen Temperaturen arbeiten, also viel Energie verbrauchen. Die plasmonische Katalyse wäre ungleich nachhaltiger und könnte zukunftsträchtig etwa für die Produktion von «grünem» Wasserstoff eingesetzt werden: mithilfe von Gold-Nanopartikeln im Sonnenbad.
«In diesem Bereich bin ich am längsten tätig, weil ich mich schon in meiner Doktorarbeit damit beschäftigt habe», sagt Tagliabue. «Dank dieser Vorarbeiten stützt sich unsere Arbeit auf ein sehr grundlegendes Verständnis dieser mikroskopischen Prozesse.» Was Früchte trägt: Wie vor einiger Zeit in der Fachzeitschrift «Light: Science and Applications» berichtet, konnte das Team einen bislang unbekannten Effekt bei der Interaktion von Nanogold mit Licht nachweisen.
Neuartige Linsen
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt sind die Thermonanophotonics for Reconfigurable Systems, bei der es im Kern um die Interaktion von Nanomaterialien mit Licht und mit Wärme geht. Hier erhofft sich die Forschung etwa für die Sensorik oder Optoelektronik innovative Systeme, die ihre Struktur oder ihre Funktionen reversibel, also umkehrbar, an Umweltbedingungen anpassen können. «Ein Beispiel wären Linsen für bildgebende Anwendungen», sagt Tagliabue. Die Rede ist von sogenannten Metalinsen: neuartige optische Bauteile, die Licht nicht wie herkömmliche Linsen fokussieren, sondern auf Oberflächen mit Nanostrukturen beruhen. Dadurch können sie bis zu 1000-mal flacher ausfallen und künftig bisher unerreicht kompakte, leichte und kostengünstige optische Systeme ermöglichen. Anwendungsbereiche wären zum Beispiel Smartphone-Kameras oder medizinische Endoskope.
«Es ist bereits bekannt, wie man Metalinsen perfekt flach herstellt», sagt Tagliabue. «Aber wir würden ihre Eigenschaften gerne nachträglich verändern. Das hängt von ihrer Struktur ab, die wir über die Temperatur – also über das Licht – beeinflussen wollen. Ein Beispiel wäre eine Linse, die bei Raumtemperatur eine bestimmte Brennweite hat, die sich aber ändern könnte, wenn die Linse mit Licht bestrahlt und erwärmt wird. Wir könnten das ohne Berührung tun, wenn die Linse nur schwer zugänglich ist.»
Elektrische Ströme
Der dritte Forschungsbereich ist die Hydrovoltaic Generation – die Nutzung der Verdunstung von Wasser. Etwa die Hälfte der Sonnenenergie, die auf die Erde trifft, feuert diesen Vorgang an. Er steht für ein enormes Energiepotenzial, weil die Verdunstung einen kontinuierlichen Wasserfluss antreibt: wie eine Pumpe. Das lässt sich mithilfe spezieller Geräte nutzen, die in ihrem Inneren nanogrosse Kanäle haben. Strömt Wasser durch sie hindurch, um zu verdunsten, entstehen elektrische Ströme und Spannung.
Diese Geräte sind noch nicht reif für eine industrielle Anwendung, auch weil bisher nicht alle relevanten Effekte verstanden sind. Tagliabue und ihr Team haben eine neuartige experimentelle Plattform mit präzise angeordneten Silizium- Nanosäulen entwickelt, um den hydrovoltaischen Effekt der Verdunstung unter streng kontrollierten Bedingungen zu testen. Wie sie in der Fachzeitschrift «Cell Press Device» berichten, konnten sie damit eine wichtige Erkenntnis gewinnen. «Solche Hydrovoltaikgeräte müssen, anders als bislang angenommen, nicht mit hochgereinigtem Wasser betrieben werden», sagt Tagliabue. «Sie funktionieren auch mit Leitungs- oder Meerwasser.»
Dies könnte spannende Anwendungsmöglichkeiten in Ergänzung zu bestehenden Energieerzeugungslösungen eröffnen. «Ich denke, wir brauchen einen Mix aus nachhaltigen Ansätzen, die wir flexibel und je nach Umweltbedingungen einsetzen können», sagt sie über die Energieversorgung der Zukunft. «Und dieser Ansatz könnte uns eine weitere Alternative bieten.»
Mit ihrem Team möchte sie nun eine Förderung des Schweizerischen Nationalfonds auch dafür nutzen, ein hydrovoltaisches Prototypmodul unter realen Bedingungen zu testen: am Genfersee. Gleichzeitig sind aber auch kleinteilige Anwendungen denkbar, weil hydrovoltaische Geräte nur wenig verdunstende Flüssigkeit benötigen. Möglicherweise können in Zukunft also auch tragbare Fitnesstracker auf diese Weise betrieben werden – sobald der Schweiss fliesst.